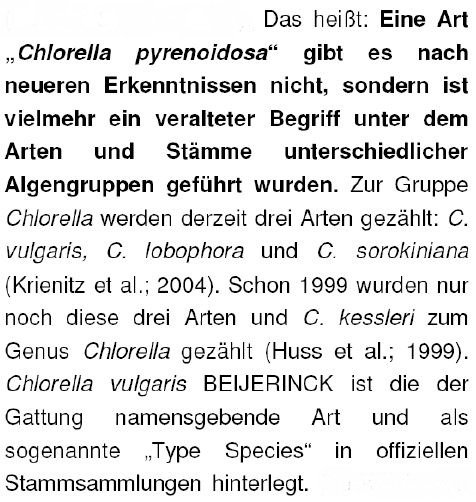Dieser medizinische Heilpilz wurde früher auch als „Coriolus versicolor“ und „Polyporus versicolor“ bezeichnet. Im deutschen Sprachgebrauch wird oft der Einfachheit halber der Name „Coriolus“ benutzt, dem ich mich in meinen weiteren Ausführungen anschließen möchte.
Der Coriolus ist ein sehr geläufiger und weltweit verbreiteter Pilz. Die Zusatzbezeichnung „versicolor“ bedeutet so viel wie „verschiedenfarbig“. Der Grund dafür liegt in der Vielfarbigkeit, mit der dieser Pilz auftreten kann. Grund für die Farbenvielfalt des Pilzes ist der Bewuchs mit Algen, vor allem Grünalgen, die ihm die unterschiedlichen Färbungen geben.
Im Englischen wird er als „Turkey Tail“ bezeichnet, also als „Truthahnschwanz“, da er gewisse Ähnlichkeiten mit einem aufgefächerten Schwanz eines wilden Truthahns aufweisen kann.
Beim Coriolus handelt es sich ökologisch gesehen um eine Baum- bzw. Holzkrankheit. Er gilt als ein Schwächeparasit. Seine bevorzugten „Opfer“ sind die Rotbuche, Eiche, Weide und Birke. Aber auch Nadelholz wird von ihm befallen.
Der Pilz zählt zu den saprobiontischen Formen. Das heißt, dass er fast ausschließlich Holz von toten oder stark geschwächten Bäumen befällt und dieses zersetzt. Damit hat er für die Waldökologie eine wichtige Recyclingfunktion. Seine Vorliebe für totes Holz macht ihm aber auch Feinde, besonders unter den Menschen, der ihn dann zum „Schädling“ befördert.
Denn er befällt Stütz- und Holzbalken und löst diese im Laufe der Zeit auf. Da der Pilz nahezu überall vorkommt und auch ganzjährig zu finden ist, wäre er ein gutes Sammelobjekt für Pilzsammler. Aber der Pilz ist ungenießbar und damit kein Speisepilz. Von daher ist es nicht verwunderlich, warum gerade dieser Pilz in unseren Breiten keine besondere Beachtung findet.
In der traditionellen chinesischen Medizin kommt der Pilz als Medikament zum Einsatz. Sein Einsatz hier soll die vitalen Energien (Chi-Energien) und das „essentielle“ Wohlbefinden verstärken, die Gesundheit allgemein verbessern und das Immunsystem und seine Funktionen harmonisieren.
Laut klassischer TCM wird dies erreicht durch eine belebende Funktion der Milz und durch die Eliminierung von Feuchtigkeit (die für die Entstehung von Rheuma verantwortlich gemacht wird). Spezielle Symptome, wie allgemeine Schwächezustände, schlechter Appetit und zu häufiger und durchfallähnlicher Stuhlgang, werden durch den Einsatz von Coriolus verbessert.
Die moderne TCM benutzt den Pilz auch bei anderen Erkrankungen, wie Hepatitis, Leberzirrhose, Nierenentzündungen und rheumatoider Arthritis. Weitere Indikationen sind hier quälender Husten und Atemprobleme, vor allem bei Asthma. Die positive Beeinflussung des Immunsystems durch den Pilz nutzt die TCM für die Behandlung des chronischen Fatigue-Syndroms und zur Behandlung von Nebenwirkungen, wie sie bei der chemotherapeutischen bzw. radiologischen Krebsbehandlung auftreten.
Coriolus und naturwissenschaftliche Arbeiten
Im Gegensatz zu Ganoderma und Cordyceps gibt es für den Coriolus fast nur Arbeiten über seine Wirksamkeit bei verschiedenen Krebserkrankungen. Im Mittelpunkt steht hier ein Polysaccharid, das vom Pilz produziert wird, und das an ein Protein gebunden ist. Dieses Polysaccharid wird Polysaccharid-K oder kurz PSK genannt.
In Japan ist PSK als Zusatzmedikation bei der Krebsbehandlung offiziell zugelassen und wird sogar von den staatlichen Krankenkassen getragen. In China kommt eine Variante zur Anwendung, das PSP oder Polysaccharid-Peptid. Die Unterschiede zum PSK sind allerdings in der Praxis zu vernachlässigen, da sie sowohl von der praktischen Wirksamkeit als auch von der biochemischen Struktur her minimal ausfallen.
Der einzige praktische Unterschied zwischen PSK und PSP liegt in der Nebenwirkungsrate. Die australische „Therapeutic Goods Administration“ deutete darauf hin, dass der WHO nur 8 Nebenwirkungen weltweit bei PSK und keine Nebenwirkung bei PSP vorlägen. Das „MD Anderson Cancer Center“ bezeichnet den Coriolus bzw. sein Polysaccharid als einen „vielversprechenden Kandidaten für die Chemotherapie aufgrund mehrfacher Wirkmechanismen auf die Krebsentstehung, wegen seiner begrenzt auftretenden Nebenwirkungen und der Sicherheit für den Patienten bei oralen Dosierungen über einen langen Zeitraum.“
Mit Japan und China als Ausnahme besteht in anderen Ländern keine offizielle Zulassung der Coriolus Polysaccharide als Teil des Behandlungskonzepts bei Krebserkrankungen.
Bevor wir uns die Wirksamkeit der Polysaccharide genauer anschauen, werfen wir einmal einen kurzen Blick auf eine Toxizitätsstudie. Denn bei nur 8 Nebenwirkungen von PSK weltweit handelt es sich um eine außergewöhnlich geringe Nebenwirkungsrate. Coriolus und auch seine isolierten Polysaccharide werden seit Generationen eingesetzt und haben, wie bereits erwähnt, in Japan und China einen festen Platz bei der Behandlung von Krebserkrankungen. Wenn wir uns einmal die Chemotherapeutika anschauen, dann steht deren Nebenwirkungsrate in keinem Verhältnis zu den 8 von PSK. (1)
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Diese Arbeit untersucht die Toxizität (Giftigkeit) von Coriolus bei Ratten. Die Autoren bemerken, dass der Pilz eine außerordentlich weite Verbreitung genießt als Medikation in der traditionellen chinesischen Medizin. Man hatte zwar in der jüngeren Vergangenheit belegen können, dass der Pilz eine Wachstumshemmung von Tumoren bewirken kann.
Gleichzeitig aber gibt es keine Kenntnisse über die mögliche toxische Wirkungen und die Sicherheit bei der Langzeiteinnahme des Pilzes bzw. von PSK. Bei der vorliegenden Arbeit wurde ein standardisierter Wasserextrakt von Coriolus verwendet, der den Ratten kurzzeitig und über einen längeren Zeitraum verabreicht wurde.
Um die akute Toxizität zu bestimmen, wurde der Coriolus den Ratten per Sonde in verschiedenen Konzentrationen zugeführt. Diese lagen bei 1250, 2500 und 5000 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag über einen Zeitraum von 28 Tagen. Während der Studienzeit wurden die Ratten in ihrem allgemeinen Verhalten beobachtet. Mortalität und offensichtliche Nebenwirkungen wurden notiert. Am Ende der Studie wurden hämatologische und biochemische Parameter erhoben.
Es wurden die Organe gewogen, um hier mögliche Veränderungen festzuhalten und die Gewebe der Ratten wurden einer mikroskopischen Untersuchung unterzogen.
Als Resultat zeigte sich, dass es keinen einzigen Todesfall gab. Das Gleiche galt auch für Zeichen von Toxizität bei der Akutphase und bei der Langzeitgabe des Pilzextrakts. Sowohl bei der akuten Einzeldosengabe als auch bei der Gabe über die 28 Studientage ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Körpergewicht, dem relativen Gewicht der Organe, den hämatologischen Parametern, der klinischen Chemie, der Gewebepathologie und dem Allgemeinzustand zwischen behandelten und unbehandelten Tieren.
Die Autoren schlossen aus ihren Beobachtungen, dass der Extrakt von Coriolus keine Nebenwirkungen bei den Ratten auslösen konnte. Diese Beobachtung schloss mit ein, dass man durch diese Arbeit keine wirklich eindeutige letale Dosierung hat feststellen können. Bei einer Dosierung von 5000 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht müsste ein Mensch mit einem Körpergewicht von 80 Kilogramm 400 Gramm Pilzextrakt zu sich nehmen, um mit der Dosierung in dieser Studie „konkurrieren“ zu können.
Bei 400 Gramm fehlen nur noch 100 Gramm, damit ein halbes Kilogramm zusammen kommt. Das zeigt, welch hohen Dosierungen die Ratten ausgesetzt worden waren. Mit dieser Arbeit wurde eindrucksvoll belegt, wie niedrig ein mögliches toxisches Potential seitens des Coriolus ist.
Natürlich taucht sofort die Frage auf, ob ein so nebenwirkungsarmes „Präparat“ denn überhaupt wirksam sein kann. Denn das pharmakologische Dogma der Schulmedizin lautet, dass ohne Nebenwirkungen keine Wirkung zu erwarten ist. Dies mag auch mit ein Grund sein, warum in den USA und Europa praktisch kaum eine schulmedizinische Einrichtung auf den Pilz zurückgreift. (2)
Bei dieser Studie handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde, Plazebo kontrollierte Studie, deren Ziel es war, die Überlebensrate, den Einfluss von Coriolus auf den Lungenkrebs und den Immunstatus der Patienten zu bestimmen. Insgesamt wurden 68 Patienten in die Studie aufgenommen.
Alle Patienten litten unter einem kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (III und IV), der nicht operabel war. Die Lebenserwartung lag bei 12 Wochen. Keiner der Patienten hatte in den letzten 4 Wochen vor Studienbeginn eine Chemotherapie oder Bestrahlung erfahren.
Die Patienten wurden in 2 Gruppen eingeteilt, die Plazebogruppe und die Verumgruppe, die PSP erhielt. Die Medikation erfolgte 3 Mal am Tag über einen Zeitraum von 4 Wochen. Klinische Tests und Labortests wurden zu Beginn und am Ende der Studie durchgeführt. Gemessen wurden die Wirksamkeit von PSP auf die Mortalität und Morbidität (gesundheitliche Verschlechterung). Zusätzlich wurde ein Sicherheitsprofil für PSP erstellt. Patienten und behandelnde Ärzte und Personal waren „blind“, d.h. keiner der Beteiligten wusste, wer PSP und wer Plazebo bekam. Die Patienten mussten mindestens 2 Wochen in Behandlung sein, um für die Auswertung qualifiziert zu sein.
Zu Beginn der Studie gab es keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bezüglich der ursprünglichen Behandlungen, Stadien und Allgemeinzustand. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen war das signifikant höhere Alter der Verumgruppe. Alle Patienten zeigten eine 100-prozentige Compliance während der Studie. Als Ergebnis zeigte sich eine signifikante Erhöhung der IgG- und IgM-Spiegel bei der PSP-Gruppe nach 4 Wochen. Die Plazebogruppe zeigte hier keine Veränderungen.
Die Zahl der Leukozyten und Neutrophile erhöhte sich signifikant in der Verumgruppe, während sie in der Plazebogruppe sank. Der BMI (body mass index) war für beide Gruppen vergleichbar. Die Verumgruppe erhöhte sich deutlich der prozentuale Anteil an Körperfett, der in der Plazebogruppe gleich blieb.
Allerdings hatte die Verumgruppe einen niedrigeren Anteil an Körperfett zu Beginn der Studie. Die erhöhten Hämoglobinwerte in der Verumgruppe waren nicht signifikant. Es zeigte sich keine Verbesserung der krebsbedingten Symptome. Der wichtigste Befund für PSP war eine deutliche Verlangsamung des Krankheitsverlaufs, da deutlich weniger Patienten in der Verumgruppe wegen Verschlechterung der Allgemeinlage aus der Studie herausgenommen werden mussten (5.9 gegenüber 23,5 Prozent). In keiner der beiden Gruppen wurden Nebenwirkungen beobachtet.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:
Die Autoren schlossen aus diesen Beobachtungen, dass eine PSP-Behandlung für eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs von kleinzelligem Lungenkrebs verantwortlich gemacht werden kann.
Natürlich mag es enttäuschend sein, hier keine „spektakulären“ Ergebnisse sehen zu können. Aber man muss sich hier vor Augen halten, dass alle Patienten schon eine ausgereizte Chemo- und/oder Strahlentherapie hinter sich hatten, aber trotzdem sich immer noch in einem fortgeschrittenen Stadium (III und IV) befanden. Hier hatten also die schulmedizinischen Bemühungen ebenfalls keine „spektakulären“ Ergebnisse bringen können.
Vor diesem Hintergrund ist eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs eine bemerkenswerte Beobachtung. Die Beobachtungszeit von 4 Wochen scheint auch ein wenig zu kurz zu sein, um bessere Ergebnisse zu bekommen. (3)
Ziel dieser Studie war, die Überlebenszeit und das Ansprechen der Therapie mit der Kombination Tegafur/Uracil (Chemotherapeutika-Kombination) und PSK zu bewerten. Dazu wurde eine Arbeit mit 205 Patienten durchgeführt, die randomisiert und kontrolliert ausgeführt wurde. Besonderheit dieser Studie ist, dass die Verumgruppe die doppelte Anzahl an Patienten enthielt (n=137) als die Kontrollgruppe (n=68). Alle Patienten litten unter einem gesicherten Dickdarmkrebs (kolorektal), waren jünger als 75 Jahre, hatten nachweisbare immunsuppressive saure Protein Konzentrationen und hatten einen Primärtumor im Stadium II und III.
Alle Patienten wurden zuvor operativ behandelt. Unmittelbar nach der operativen Entfernung des Darms wurden die Patienten zufallsbedingt den beiden Gruppen zugeordnet. Die Verumgruppe erhielt täglich 3 Gramm PSK und die Tegafur/Uracil Kombination 300 Milligramm, während die Kontrollgruppe nur die Kombination, aber kein PSK erhielt. Die Behandlung erfolgte über 2 Jahre. Alle Patienten erhielten initial eine Bolusinjektion mit Mitomycin C an den beiden ersten Tagen nach der Operation. Mitomycin ist ein Antibiotikum, dass heute aber nur noch als Chemotherapeutikum eingesetzt wird.
Der Beobachtungszeitraum lag bei 5 Jahren für beide Gruppen. Die primären Beobachtungsziele der Studie waren erkrankungsfreie und generelle Überlebensraten, Todesursachen und Rezidive.
Zu Beginn der Studie gab es nur einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen: Der Befund der Gewebeuntersuchungen ergab ein fortgeschritteneres Stadium für die PSK-Gruppe. Trotzdem hatte die Verumgruppe weniger Rezidive zu verzeichnen (23,3 gegen 36,5 %).
Der Unterschied war aber nicht statistisch signifikant. Die krebsfreie 5-Jahres-Überlebensrate war in der Verumgruppe signifikant höher als in der Kontrollgruppe (73 gegen 58,8 % der Patienten). Eine Untergruppen-Analyse von Stadium III Patienten ergab eine krebsfreie 5-Jahres-Überlebensrate von 74,6 Prozent für die Verumgruppe und nur 46,4 Prozent für die Kontrollgruppe. PSK verhinderte darüber hinaus auch signifikant das Auftreten von Rezidiven, besonders von Lungenmetastasen. Nebenwirkungen waren selten und von milder Natur. Von daher war die Compliance seitens der Patienten gut.
Das Urteil der Autoren lautete, dass die Kombination von PSK und Tegafur/Uracil das Auftreten von Rezidiven im Stadium II und III eines Dickdarmkrebs verhindern kann, und dass die Überlebenszeit in Stadium III signifikant verlängert werden kann. (4)
Auch in dieser Studie geht es wieder um Dickdarmkrebs nach einer operativen Entfernung des Darms. Die Autoren bemerken, dass für Patienten mit Dickdarmkrebs eine Überlebenszeit von 5 und mehr Jahren das wünschenswerte Ziel therapeutischer Bemühungen darstellt. Diese Studie war eine retrospektive Datenanalyse, die die 10-Jahres-Überlebenszeit von Patienten mit einer konventionellen Krebstherapie und Patienten mit konventioneller Therapie plus PSK verglich. PSK wurde den Patienten mindestens 24 Monate verabreicht.
Das Ergebnis zeigte, dass die 10-Jahres-Überlebensrate für die PSK-Gruppe bei 81,9 Prozent lag, was signifikant besser war als die der Kontrollgruppe mit 50,6 Prozent. In Fällen von „Dukes´C“ war die 10-Jahres-Überlebensrate ebenfalls signifikant höher als in der Kontrollgruppe (Dukes Klassifizierung von Darmkrebs erfolgt von A bis D, wobei D das fortgeschrittenste Stadium ist. C heißt, dass die Lymphknoten mit befallen sind, also Wegbereiter für Metastasen gegeben sind). Hier ergaben sich Werte von 80,6 Prozent Überlebensrate in der PSK-Gruppe gegenüber nur 25,9 Prozent in der Kontrollgruppe.
Die Autoren schlossen daher, dass eine postoperative zusätzliche Immunochemotherapie mit PSK signifikant die Prognose für die nächsten 10 Jahre nach der Operation verbessert. Auf der Basis dieser Ergebnisse befürworten die Autoren den Einsatz von PSK bei Patienten mit der Klassifizierung „Dukes´C“.
Dass die Patienten mit „Dukes´C“ besonders von einer PSK-Gabe profitierten, mag damit zusammenhängen, dass PSK unter Umständen in der Lage ist, Metastasenbildung zu verhindern. In der vorigen Studie wurde bereits erwähnt, dass es hier unter PSK zu einer Unterbindung von Lungenmetastasen gekommen war. Da die Metastasen bei den Krebserkrankungen als die eigentliche Gefahr für den Organismus anzusehen sind, ist es nur logisch, wenn eine Substanz, wie PSK, die Krankheit „ausbremst“, indem sie die Metastasenbildung verhindert. Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr verwunderlich, dass in dieser Studie eine besonders hohe Diskrepanz zwischen Verum- und Kontrollgruppe bei „Dukes´C“ Patienten zu sehen ist, da augenscheinlich eine rein konventionelle Therapie die Metastasenbildung nicht ausreichend eindämmen kann. (5)
Bei dieser Studie handelt es sich ebenfalls um eine Meta-Analyse, die 1094 aus 3 klinischen Studien zusammenfasste. Alle 3 Studien beobachteten ihre über 5 Jahre nach der Operation. Verglichen wurden die Nachbehandlung mit Chemotherapeutika mit und ohne PSK. Die Zielvorgaben waren die Beurteilung von allgemeiner Überlebensrate und krebsfreier Überlebensrate.
Nach der statistischen Analyse der vorliegenden Daten kamen die Autoren zu dem Schluss, dass das Verhältnis von konventioneller Therapie zu konventioneller Therapie plus PSK für die allgemeine Überlebensrate 0,71 ist. Das bedeutet, dass den theoretisch 100 überlebenden Patienten der konventionellen Therapie plus PSK nur 71 Überlebende der reinen konventionellen Therapie nach einem Zeitraum von 5 Jahren gegenüber stehen. Für die krebsfreie Überlebensrate betrug dieser Wert 0,72. Damit zeigen die Ergebnisse dieser Meta-Analyse, dass eine Therapie mit PSK die Überlebensrate allgemein und die erkrankungsfreie Überlebensrate deutlich erhöhen kann. (6)
Diese Arbeit untersucht vorliegende Daten aus Studien über Magenkrebs. Hierbei verglichen die Autoren die Resultate der Chemotherapie mit denen einer Therapie mit PSK. Die vorliegende Meta-Analyse schloss 8009 Patienten ein aus 8 randomisierten, doppelblinden, Plazebo kontrollierten Studien. Die Analyse der vorliegenden Daten ergab eine verbesserte Überlebensrate von 0,88 (100 Überlebende der PSK-Gruppe gegen 88 der Chemotherapeutika-Gruppe). Daraus schlossen die Autoren, dass eine Zusatztherapie mit PSK die Überlebensrate von Patienten mit Magenkrebs und anschließender operativer Entfernung deutlich erhöht. (7)
Nachdem eine lebensverlängernde Wirksamkeit von PSK bei Magenkrebs sicher zu sein scheint, geht es den Autoren in dieser Arbeit darum, einen möglichen Wirkmechanismus zu beschreiben. Dazu beobachteten sie eine Reihe von immunologischen Parametern, wie Th1-Zellen (IFN-gamma-positive CD4+ T-Zellen), Th2-Zellen (Interleukin-4-positive CD4+ T-Zellen), das Verhältnis von Th1 und Th2, Natürliche Killerzellen (CD56+ und CD57+ T-Zellen) und T-Zellen mit CD25+ und CD4+ Antigenen. Die Patienten wurden zufallsbedingt in eine PSK-Gruppe zugewiesen, deren Mitglieder täglich 3 Gramm PSK und 300 Milligramm Tegafur/Uracil bekamen, oder in eine Gruppe mit ausschließlich 300 Milligramm Tegafur/Uracil als Behandlung. Die Behandlung dauerte mindestens 1 Jahr nach erfolgter Operation.
Insgesamt wurden 21 registrierte Patienten mit Stadium III Magenkrebs untersucht. Die 3-Jahres-Überlebensrate betrug bei der PSK-Gruppe 62,2 Prozent; bei der Kontrollgruppe dagegen nur 12,5 Prozent, ein statistisch signifikanter Unterschied. Vor der Operation bestand kein deutlicher Unterschied bei Th1-Zellen, Th2-Zellen, dem Verhältnis von Th1 und Th2, CD56+ T-Zellen, CD57+ T-Zellen, Natürlichen Killerzellen und CD4+/CD25+ T-Zellen zwischen den beiden Gruppen. Nach der Operation jedoch sank der Bestand an CD57+Zellen signifikant in der PSK-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Nach einer Analyse aller Patienten zeigte sich, dass Patienten mit einem erhöhten Verhältnis von mehr als 18 Prozent von CD57+Zellen eine deutlich schlechtere Prognose aufwiesen als die mit geringeren CD57+Werten.
Die 3-Jahres-Überlebensrate lag hier bei 25 Prozent gegenüber 45,7 Prozent für die erniedrigten CD57+Werte. Damit bestätigte sich die Hypothese, dass hohe CD57+Werte ein Indikator für eine schlechte Prognose bei fortgeschrittenem Magenkrebs darstellen. Jedoch in der Gruppe, die mit PSK zusätzlich behandelt worden war, war die 3-Jahres-Überlebensrate von Patienten mit hohen CD57+Werten annähernd gleich hoch wie bei den Patienten mit niedrigem CD57+ (66,7 gegen 51,4 Prozent).
Die Schlussfolgerung der Autoren war, dass PSK die allgemeine Überlebensrate von Stadium III Magenkrebskranken erhöht durch eine Hemmung von CD57+ T-Zellen. (8)
Diese „ofenfrische“ Arbeit beschäftigt sich mit PSP und Prostatakrebs. Das Besondere an dieser Arbeit ist der Einsatz von PSP. Während bei einer konventionellen Krebstherapie, so die Autoren, nur die bereits ausdifferenzierten Formen der Krebszellen therapiert werden, versucht eine Therapie mit PSP bereits die Vorformen zu beeinflussen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:
Diese Vorformen sind Prostatakrebs-Stammzellen, die den Erkrankungsverlauf initiieren. In vitro wurden Krebszellkulturen mit PSP behandelt, was zu einem Abnehmen der Stammzellen-Marker führte. Diese Abnahme war zeit- und dosisabhängig. Aber auch unter in vivo Bedingungen wurde eine zytotoxische Wirkung von PSP auf die Krebsstammzellen beobachtet. So wurden Mäuse, die spontan maligne Prostatatumore entwickeln, über einen Zeitraum von 20 Wochen mit PSP gefüttert.
Die Kontrollgruppe von Mäusen, die kein PSP erhielten, zeigten zu 100 Prozent Prostatatumore. Die PSP-Mäuse dagegen waren vollkommen tumorfrei nach 20 Wochen. Dies legt die Vermutung nahe, dass PSP in der Lage ist, das Aufkeimen von Prostatakrebs schon im „Vorfeld“ zu unterdrücken, indem die Stammzellen, die zu Prostatakrebszellen degenerieren, eliminiert werden. Diese Beobachtung ist eine neue und überraschende Variante in der Ausbildung von chemoprotektiven Eigenschaften von oralem PSP bei Prostatakrebs. (9)
Als vorläufig „letzter Streich“ eine Arbeit, die mit dem Krebsgeschehen weniger zu tun hat.
Bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Colitis ulcerosa liegen verstärkte Entzündungsreaktionen im Gastrointestinaltrakt vor. Das Ziel dieser Arbeit war daher, den entzündungshemmenden Effekt von Coriolus bei diesen Erkrankungen zu beschreiben. Zu diesem Zweck wurde bei Mäusen durch die Verfütterung von Dextran-Sodium-Sulfat (DSS) künstlich ein Entzündungsprozess im Darm ausgelöst.
Die Mäuse wurden in 4 experimentelle Gruppen eingeteilt:
- Gruppe 1 war die Kontrollgruppe
- Gruppe 2 mit DSS-induzierter Colitis
- Gruppe 3 Behandlung mit Coriolus-Extrakt
- Gruppe 4 erfuhr eine Behandlung mit Coriolus-Extrakt bei gleichzeitiger DSS-Colitis
Die Mäuse, die DSS bekommen hatten, entwickelten klinische und sichtbare Zeichen einer Colitis ulcerosa. Eine Behandlung mit Coriolus-Extrakt jedoch verbesserte die Symptome der Colitis, inklusive einer Abnahme von Körper- und Organgewicht. Die Konzentrationen von IgE-Antikörpern in Serum, Milz und Lymphknoten war in der Coriolus-Gruppe (Gruppe 4) deutlich niedriger als in der unbehandelten Gruppe 2.
Gleichzeitig war eine anti-entzündliche Reaktion durch den Coriolus-Extrakt zu sehen, der sich in einer reduzierten Produktion von Tumor-Nekrose-Faktor, Interleukin-1 und Interleukin-6 bemerkbar machte. Diese Beobachtung lässt den Schluss zu, dass die anti-entzündliche Wirksamkeit von Coriolus auf einer Hemmung der entzündungsfördernden Zytokine beruht.
Bewertung und Fazit
Da es für diesen Heilpilz kaum nicht-krebsbezogene wissenschaftliche Arbeiten zu geben scheint, lässt sich kaum etwas über die Wirksamkeit des Coriolus bei Diabetes, Hochdruck, Arthritis, Allergien und anderen wichtigen und interessanten Indikationen sagen. Dafür gibt es eine große Zahl an Literatur über den positiven Einfluss auf verschiedene Krebserkrankungen.
Laut MD Anderson Cancer Center gibt es alleine 40 klinische Arbeiten an Patienten, von denen die meisten PSP und vor allem PSK auf ihren Einfluss auf verschiedene Krebserkrankungen untersuchen. Bis auf wenige Ausnahmen, bei denen die Autoren keine signifikanten Unterschiede zu Plazebo bzw. konventioneller Therapie haben sehen können, kommen die meisten dieser Arbeiten zu überwältigend positiven Ergebnissen, besonders wenn es um die Überlebensraten geht. Damit empfiehlt sich der Coriolus fast als ein „Muss“ für jede Krebstherapie als Zusatz zur konventionellen Therapie.
Da der Heilpilz aber auch in der Lage zu sein scheint, krebsbildende Vorläuferzellen zu eliminieren, liegt auch hier der Verdacht nahe, dass der Coriolus ein ausgezeichnetes Mittel zur Krebs-Prophylaxe darstellt. Der Vorteil einer Prophylaxe mit Hilfe des Coriolus liegt darin, dass der Pilz auch noch mit wertvollen Nähr- und Mineralstoffen aufwarten kann, so dass der Benutzer gleichzeitig eine besonders gute Ernährung sich zugute kommen lässt.
(1) Hor et al. Acute and subchronic oral toxicity of Coriolus versicolor standardized water extract in Sprague-Dawley rats.
School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia. J Ethnopharmacol. 2011 Jul 8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21767625
(2) Tsang et al.
Coriolus versicolor polysaccharide peptide slows progression of advanced non-small cell lung cancer.
Department of Medicine, The University of Hong Kong, Queen Mary Hospital, Pokfulam, Hong Kong SAR, China
Respir Med 2003 Jun;97(6):618-24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12814145
(3) Ohwada et al.
Adjuvant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised controlled study.
Department of Surgery, Gunma University, Graduate School of Medicine, Gunma Oncology Study Group, Gunma, Japan.
Br J Cancer. 2004 Mar 8;90(5):1003-10.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14997197
(4) Sakai et al.
Immunochemotherapy with PSK and fluoropyrimidines improves long-term prognosis for curatively resected colorectal cancer.
Department of Surgery, Fukseikai Hospital, Fukuoka, Japan
Cancer Biother Radiopharm. 2008 Aug;23(4):461-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18771350
(5) Sakamoto et al.
Efficacy of adjuvant immunochemotherapy with polysaccharide K for patients with curatively resected colorectal cancer: a meta-analysis of centrally randomized controlled clinical trials.
Department of Epidemiological& Clinical Research Information Management, Kyoto University Graduate School of Medicine, Yoshidakonoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Japan.
Cancer Immunol Immunother. 2006 Apr;55(4):404-11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16133112
(6) Oba et al.
Efficacy of adjuvant immunochemotherapy with polysaccharide K for patients with curative resections of gastric cancer.
Department of Epidemiological and Clinical Research Information Management, Kyoto University Graduate School of Medicine, Japan.
Cancer Immunol Immunother. 2007 Jun;56(6):905-11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17106715
(7) Akagi und Baba
PSK may suppress CD57(+) T cells to improve survival of advanced gastric cancer patients.
National Hospital Organization Kumamoto Minami Hospital, Toyofuku, Matubase-machi, Kumamoto, Japan.
Int J Clin Oncol. 2010 Apr;15(2):145-52.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20229169
(8) Luk et al.
Chemopreventive effect of PSP through targeting of prostate cancer stem cell-like population.
Department of Anatomy, The University of Hong Kong..
PLoS One. 2011;6(5):e19804.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21603625
(9) Lim
Coriolus versicolor Suppresses Inflammatory Bowel Disease by Inhibiting the Expression of STAT1 and STAT6 Associated with IFN-γ and IL-4 Expression.
College of Biomedical and Health Science, Department of Applied Biochemistry, Konkuk University, Chungju, Chungbuk, Korea.
Phytother Res. 2011 Aug;25(8):1257-61. doi: 10.1002/ptr.3378.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21796702
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Beitragsbild: pixabay.com-fjord77